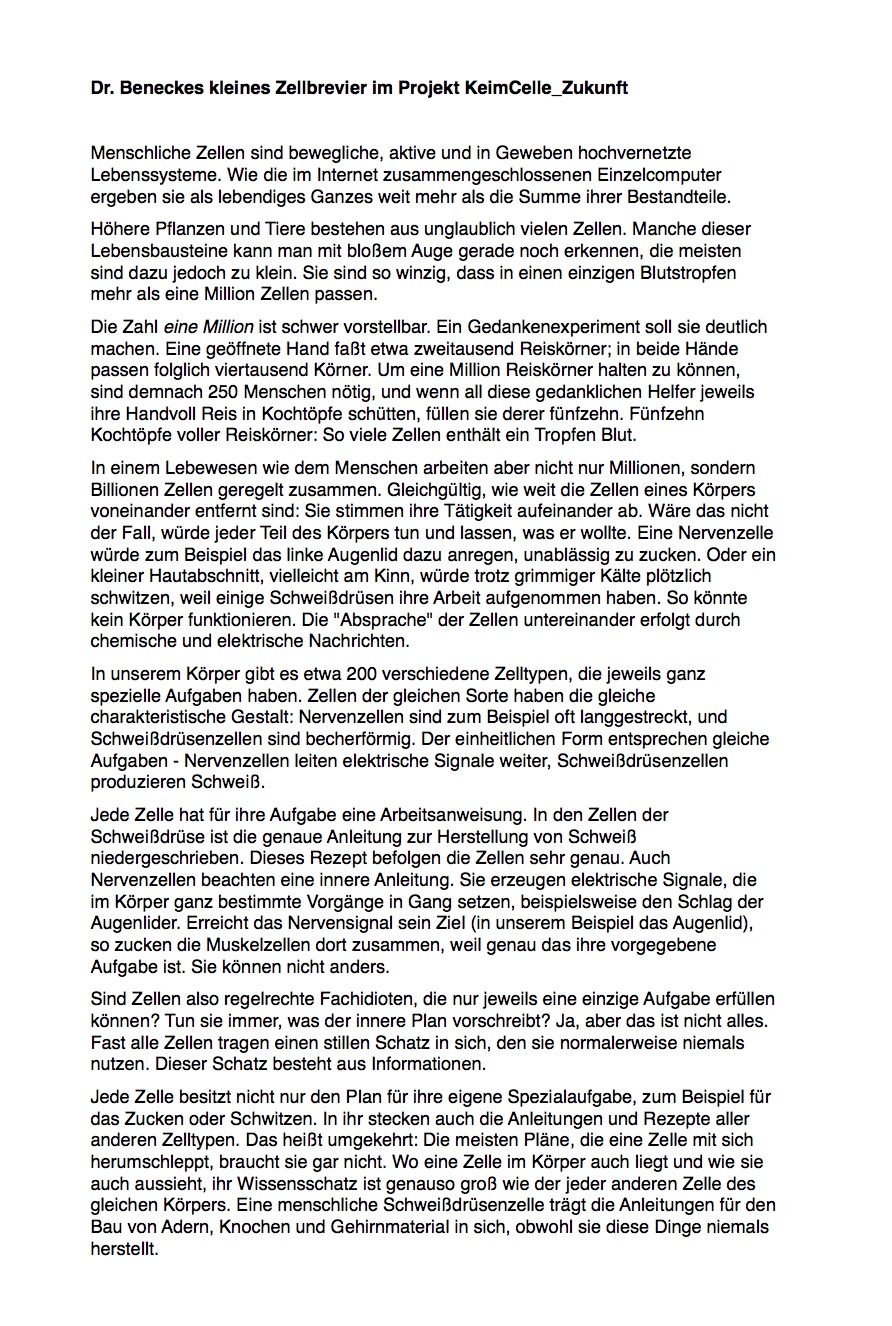2000 10: Dr Beneckes kleines Zellbrevier
Quelle: EXPO Hannover 2000
Dr. Beneckes kleines Zellbrevier im Projekt KeimCelle_Zukunft
[Weitere Artikel von MB] [Artikel über MB]
[Mehr über DNA und DNA-Typisierung]
Von Mark Benecke
Dr. Beneckes kleines Zellbrevier im Projekt "KeimCelle_Zukunft"
Menschliche Zellen sind bewegliche, aktive und in Geweben hochvernetzte Lebenssysteme. Wie die im Internet zusammengeschlossenen Einzelcomputer ergeben sie als lebendiges Ganzes weit mehr als die Summe ihrer Bestandteile.
Höhere Pflanzen und Tiere bestehen aus unglaublich vielen Zellen. Manche dieser Lebensbausteine kann man mit bloßem Auge gerade noch erkennen, die meisten sind dazu jedoch zu klein. Sie sind so winzig, dass in einen einzigen Blutstropfen mehr als eine Million Zellen passen.
Die Zahl eine Million ist schwer vorstellbar. Ein Gedankenexperiment soll sie deutlich machen. Eine geöffnete Hand faßt etwa zweitausend Reiskörner; in beide Hände passen folglich viertausend Körner. Um eine Million Reiskörner halten zu können, sind demnach 250 Menschen nötig, und wenn all diese gedanklichen Helfer jeweils ihre Handvoll Reis in Kochtöpfe schütten, füllen sie derer fünfzehn. Fünfzehn Kochtöpfe voller Reiskörner: So viele Zellen enthält ein Tropfen Blut.
In einem Lebewesen wie dem Menschen arbeiten aber nicht nur Millionen, sondern Billionen Zellen geregelt zusammen. Gleichgültig, wie weit die Zellen eines Körpers voneinander entfernt sind: Sie stimmen ihre Tätigkeit aufeinander ab. Wäre das nicht der Fall, würde jeder Teil des Körpers tun und lassen, was er wollte. Eine Nervenzelle würde zum Beispiel das linke Augenlid dazu anregen, unablässig zu zucken. Oder ein kleiner Hautabschnitt, vielleicht am Kinn, würde trotz grimmiger Kälte plötzlich schwitzen, weil einige Schweißdrüsen ihre Arbeit aufgenommen haben. So könnte kein Körper funktionieren. Die "Absprache" der Zellen untereinander erfolgt durch chemische und elektrische Nachrichten.
In unserem Körper gibt es etwa 200 verschiedene Zelltypen, die jeweils ganz spezielle Aufgaben haben. Zellen der gleichen Sorte haben die gleiche charakteristische Gestalt: Nervenzellen sind zum Beispiel oft langgestreckt, und Schweißdrüsenzellen sind becherförmig. Der einheitlichen Form entsprechen gleiche Aufgaben - Nervenzellen leiten elektrische Signale weiter, Schweißdrüsenzellen produzieren Schweiß.
Jede Zelle hat für ihre Aufgabe eine Arbeitsanweisung. In den Zellen der Schweißdrüse ist die genaue Anleitung zur Herstellung von Schweiß niedergeschrieben. Dieses Rezept befolgen die Zellen sehr genau. Auch Nervenzellen beachten eine innere Anleitung. Sie erzeugen elektrische Signale, die im Körper ganz bestimmte Vorgänge in Gang setzen, beispielsweise den Schlag der Augenlider. Erreicht das Nervensignal sein Ziel (in unserem Beispiel das Augenlid), so zucken die Muskelzellen dort zusammen, weil genau das ihre vorgegebene Aufgabe ist. Sie können nicht anders. Sind Zellen also regelrechte Fachidioten, die nur jeweils eine einzige Aufgabe erfüllen können? Tun sie immer, was der innere Plan vorschreibt? Ja, aber das ist nicht alles. Fast alle Zellen tragen einen stillen Schatz in sich, den sie normalerweise niemals nutzen. Dieser Schatz besteht aus Informationen.
Jede Zelle besitzt nicht nur den Plan für ihre eigene Spezialaufgabe, zum Beispiel für das Zucken oder Schwitzen. In ihr stecken auch die Anleitungen und Rezepte aller anderen Zelltypen. Das heißt umgekehrt: Die meisten Pläne, die eine Zelle mit sich herumschleppt, braucht sie gar nicht. Wo eine Zelle im Körper auch liegt und wie sie auch aussieht, ihr Wissensschatz ist genauso groß wie der jeder anderen Zelle des gleichen Körpers. Eine menschliche Schweißdrüsenzelle trägt die Anleitungen für den Bau von Adern, Knochen und Gehirnmaterial in sich, obwohl sie diese Dinge niemals herstellt.
Und wenn es nur um die Information ginge, könnte eine Nervenzelle genauso gut Fett produzieren wie die entsprechenden Zellkollegen im Gesäß. Nur - sie tut es nicht. Das hat zwei Gründe. Erstens beauftragt niemand die Zellen damit, auf einmal eine andere Funktion auszuüben. Dazu gibt es auch keinen Grund. Warum sollte eine Nervenzelle im Gehirn die Aufgabe einer Gesäßzelle übernehmen müssen? Zweitens haben die Zellspezialisten oft schon eine Lage im Körper eingenommen, die ihnen eine neue Aufgabe unmöglich macht, selbst wenn sie zu einer solchen veranlasst würden. Eine in den Knochen eingemauerte Zelle kann keine Tränen nach außen entlassen, und eine Fettzelle kann nicht am Denken teilnehmen. Dazu müsste sie ins Gehirn wandern, sich dort sehr lang strecken, mit Isoliermaterial umhüllen und Anschlüsse zu Nerven bilden. Ein Ding der Unmöglichkeit. Warum also werfen die Zellen ihre "überflüssigen" Baupläne nicht fort?
Sie tun es nicht, weil die scheinbar überflüssigen Informationen höchst wertvoll sein können. Sie sind ein Überbleibsel aus alten Tagen, als es noch unsterbliche Geschöpfe gab. Diese Lebewesen bestanden aus einer einzigen Zelle und brauchten sämtliche Arbeitsanleitungen, weil sie alles selbst tun mussten. Obwohl es nötig war, Nahrung aufzuspüren, zu erbeuten und zu verdauen, gab es beispielsweise noch keine speziellen Seh-, Kaumuskulatur- oder Darmzellen.
Manchmal ist es auch beim Menschen nützlich, dass noch jede Zelle alle Pläne in sich trägt. Einige Zelltypen können nicht nur eine spezielle Arbeitsvorschrift lesen, sondern je nach dem Zustand der Umgebung auch zuvor “überflüssige” Anleitungen. Wenn eine Wunde heilt und anschließend die passenden Gewebe - meist Haut und Muskeln - wieder eingebaut werden, sind solche Multitalente am Werk. Meistens schwimmen sie im Blut herum und warten nur darauf, dass ein Unfall passiert. Sobald das Notsignal kommt, werden sie im Blutstrom an Ort und Stelle transportiert. Dort verhalten sie sich wie ein Notarzt, der am Unfallort das jeweils geeignete Instrument aus seinem Rettungskoffer zieht. Blutverklumper, fördernde Stoffe zur Bildung neuer Haut und Muskeln sowie schmerzlindernde Substanzen sind nur einige der Hilfsmittel, über die solche Rettungszellen (Thrombozyten, Leukozyten und Fibroblasten) verfügen.
Mitochondrien
Die manchmal als Zellmotoren bezeichneten Mitochondrien sind vor allen dadurch bekannt, dass zwischen ihren beiden Wandlagen wichtige Schritte der zellulären Energieumwandlung, der Atmungskette, stattfinden. Dieser Raum heißt die Matrix. In der stark gewundenen Innenlage eines Mitochondriums findet sich zudem ein Enzym, das die Zusammensetzung des wichtigen Energieträgers ATP (Adenosintriphosphat) bewirkt. Lebende Mitochondrien zu beobachten ist sehr spannend: Entgegen der Erwartung wandern in vielen Zellen aberdutzende von Mitochondrien umher, anstatt wie im Schulbuch an ihrem Platz zu verharren. Manchmal streckt und windet sich ein einzelnes Mitochondrium – vergleichbar den Darmschlingen im Bauch – derart in alle Richtungen, dass man auf einem Schnittbild viele einzelne angeschnittene Mitochondrien zu sehen glaubt.
Zellhülle/Zellmembran
Menschliche Zellen haben - anders als Pflanzenzellen - keine feste Wand. Dennoch ist die Zellmembran ein starkes, hochraffiniertes Gebilde. Sie besteht aus zwei spiegelbildlich angeordneten Mischlagen aus Fetten und Proteinen, in denen alle Einzelteile frei gegeneinander beweglich sind - dennoch bleibt die Membran stets dicht. Wegen dieser Mischung aus Flexibilität und Festigkeit können sich Vesikel mit der Zellhülle verbinden und wieder von ihr abzuschnüren, und es können neue Bestandteile eingebaut werden (beispielsweise Tunnel und Signalüberträger). Darüber hinaus ist Platz für Brücken aller Art zu benachbarten Zellen; auch jene werden dauernd auf- und ab- und umgebaut. Mechanisch gestützt wird die Zellhülle durch ein stark verwobenes Innenskelett, das aus dünnen Filamenten (Fäserchen) besteht.
Golgi-Apparat und Endoplasmatisches Retikulum
Der Name trügt: Das Netzchen, reticulum, ist in Wahrheit ein das gesamte Cytoplasma dynamisch durchdringendes System. Es gleicht einer Mischung aus Rohrpostsortieranlage, Formel-1-Boxenstop, Chemielabor und Weltraumhafen.
Als Zellkernhülle bestimmt das glatte Retikulum mit seinen Poren, Transportkapselabschnürungen und molekularen Tunnelsystemen, welche Signale das Erbsubstanz-Gehirn der Zelle, den Kern, erreichen bzw. welche Signale der Kern abgeben kann. Dieser innere Teil des Retikulums heißt glatt, weil er im Gegensatz zu dem daran unmittelbar anschließenden Retikulumslabyrinth keine im Elektronenmikroskop kugelförmig aussehenden Ribosomen enthält. Die Ribosomen des rauhen Retikulums dienen der Proteinherstellung. Sehr oft werden die dort frisch zusammengesetzen Proteine zunächst in den Innenraum des rauhen Retikulums überführt. Von dort aus schleusen Golgi-Transportvesikel sie über lange Wege in den Golgi-Apparat ein- und aus. An Proteine, die später von der Zelle abgegeben werden, heftet der Golgi-Apparat beispielsweise oft kurze Zuckerbausteine an.
Vesikel
Zerschneidet man ein Zelle in nur wenige Mikrometer dünne Scheibchen und betrachtet diese unter dem Elektronenmikroskop, so werden viele kleine kreisförmige Vesikel sichtbar. Deren Hülle besteht aus demselben Material wie die übrigen Abgrenzungen der Zelle auch, etwa die äussere Zellhülle, der Golgi-Apparat und die Zellkernhülle. In den membranumhüllten Transport- und Lagerkapseln (Lysosom-Vesikeln) spielen sich viele Verdauungsvorgänge der Zelle ab. Der Zellbiologe Neil Campbell beschreibt sie so: "Membranvesikel sind Magen und Mülleimer der Zelle".
Der Trick dieser Vesikel: Sie können sowohl an innerzelluläre Strukturen andocken (etwa den Golgi-Apparat) als auch an die äußere Zellmembran. Dabei werden die Vesikel wahlweise befüllt oder entleert. Entstehen beispielsweise beim Zerlegen der aus vielen Untereinheiten bestehenden, zu verdauenden Substanzen schädliche Verbindungen, so werden diese entweder dauerhaft, aber ohne Schäden in Lagervesikeln gespeichert (Prinzip: Atommülldepot mit Stahlbetonfässern im Salzstock) oder aber aus der Zelle entfernt (Prinzip: Diskotheken-Security). Dem Menschen nützen neben den genannten Lysosomen vor allem seine Peroxysom-Vesikel - sie lagern Wasserstoffatome an Sauerstoffatome um. Dadurch können Peroxysomen sowohl Enegie für Mitochondrien liefern, als auch in der Leber Alkohol abbauen.
Leukozyten
sind die weißen Blutzellen oder weißen Blutkörperchen, darunter Lymphozyten und Granulozyten. Nur Leukozyten können die Blutbahn verlassen und ins Bindegewebe einwandern, wo sie, wie auch in der Blutbahn, Infektionen bekämpfen, zum Beispiel in dem sie Zelltrümmer oder Bakterien umfließen und verdauen. Ein Mikroliter Blut (= ein kleines Tröpfchen, wie es etwa aus einem leichten Nadelstich in der Fingerkuppe quillt), enthält etwa sechstausend Leukozyten, sehr viele Leukozyten befinden sich aber gleichzeitig in der Lymphbahn und der Zwischenzellflüssigkeit. Bei einer Infektionserkrankung bildet der Körper eine erhöhte Anzahl weißer Blutkörperchen.
Thrombozyten
werden auch Blutplättchen genannt und dienen der Blutgerinnung, vor allem zum Wundverschluss. In einem kleinen Bluttropfen finden sich weit über eine Viertelmillion dieser kernlosen Zellbruchstücke, die durch Abspaltung von großen Zellen im Knochenmark entstehen.
Fibroblasten
liegen verstreut im fasrigen Maschenwerk des lockeren Bindegewebes. Sie bilden Proteine, die sie ausscheiden, und mit denen die Körperzellen eingebettet und befestigt werden.
ATP
ist das Energieübertragungsmolekül der Zellen. Weil lebende Körper im Vergleich zu von menschlichen erbauten Maschinen nur jeweils winzige Mengen von Energie hin- und hertransportieren müssen, speichert das ATP-Molekül diese Energie in einer sehr komfortablen Weise als Bindungsenergie. Das bedeutet, dass bei der Aufnahme von Energie einige Atome an das ATP-Molekül angebaut werden: In der Bindung steckt nun eine genau bestimmte Energiemenge. Werden die Atome wieder abgespalten, so wird diese Energie wieder frei und auf die Zielmoleküle übertragen -- die Lebensfunktionen können ablaufen. Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner nennen ATP auch gerne "das Weichmachermolekül", weil die feste Totenstarre in dem Moment vollkommen ausgebildet ist, in dem alles für die Muskelbewegung notwendige ATP verbraucht oder zerfallen ist.
Proteine
sind die eigentlichen Bausteine unseres Körpers. Sie werden aus einer kleinen Anzahl von Unterbausteinen (Aminosäuren) nach dem Bauplan gebildet, der im Zellkern liegt. Umgangssprachlich nennt man Proteine auch Eiweiße.
Viren
stehen auf der Grenze zwischen dem, was Biologen als lebend und tot bezeichnen. Sie sind äußerst einfach gebaut und bestehen nur aus Erbinformation (DNA oder RNA) und einer Proteinhülle. Viren können über verschiedene Wege in lebende Zellen gelangen, beispielsweise durch einen simplen Injektionsapparat oder durch Verschmelzung mit der Zellhülle. Danach bewirkt die Virus-Erbsubstanz, dass die Zelle sich mehr und mehr der Erzeugung von Kopien der fremden Erbsubstanz sowie deren Virus-Hülle widmet -- eine schlimme Form von Piraterie und Parasitismus. Zuletzt wird die vielfach kopierte Virus-Erbsubstanz in die neu gebildeten Hüllen verpackt und kann dann weitere Zellen befallen.
Warum sind Zellen klein?
Warum sehen Menschen nicht wie riesige Amöben aus? Warum bestehen Butterblumen, Pudel, Stechapfelplanzen und Eichhörner aus Milliarden von Zellen anstatt aus nur einer Riesenzelle? Da Zellen im Gegensatz zu unserer Alltagswahrnehmung - wir spüren unsere eigenen Körperzellen nicht - enorme Mengen von Substanzen hin- und hertransportieren, umbauen, andocken, schleusen und zerstören, müssen sie möglichst viele Verbindungen zu ihren Nachbarzellen haben. Je größer eine Zelle wird, desto mehr steigt ihr Volumen in alle drei Dimensionen (Höhe, Breite und Länge). Die Oberfläche der Zelle, die als Andockfläche dient, vergrößert sich dabei aber nur in zwei Dimensionen, Breite und Länge. Wie an einem Großstadthafen, der nach einiger Zeit nicht mehr genug Raum für alle Schiffe bietet, die mit zunehmender Industrialisierung des Hinterlandes der Großstadt an- und ablegen müssten, um alle Waren zu bewegen, können auch die in der Zelle ablaufenden Stoffwechselprodukte mit zunehmendem Zellvolumen nicht mehr rasch genug transportiert werden. Deshalb müssen Zellen stets so gebaut sein, dass ein festes Verhältnis von Zellinhalt zu Oberfläche nicht überschritten wird.
Zellkern
Der Zellkern ist im Vergleich zu den anderen Zellteilen sehr groß: Er dient als gigantischer Informationsspeicher, in dem fast alle Baupläne für den Körperaufbau abgelegt sind. Dieser Informationsüberschuss ist erstaunlich, denn die meisten Zellen sind echte Spezialisten, die nur einen winzigen Teil der im Kern enthaltenen Bauanleitungen benötigen. Wahrscheinlich ist die scheinbare Verschwendung aus einer Zeit übriggeblieben, in der es noch keine mehrzelligen Lebewesen gab. Damals war jede Zelle ein in sich geschlossenes System und allein auf sich gestellt. Jede Zelle enthielt alle Baupläne und Lebensvorschriften, und jede Zelle musste alles können, um zu überleben: Orientieren, fressen, verdauen und reagieren – Leistungen, für die im Menschen jeweils einzelne Organe zuständig sind.
Informationsmenge im Zellkern
Im Laufe des Aufblühens der Lebensformen ist die Größe der Zellkernbibliotheken stark angewachsen - etwa wie Buchstabenketten auf Papier gedruckt. Sie reicht von einer Handbücherei bei Bakterien bis zu einer kompletten Stadtteilbibliothek bei der Lilie - sie enthält über hundert mal mehr Erbsubstanzmenge als ein menschlicher Zellkern. Der enorme Inhalt der Zellkern-Genome lässt sich an folgendem Vergleich ermessen: Mensch, Schimpanse und Schwein ähneln sich auf DNA-Ebene zu über 98 Prozent. Das bedeutet, dass die verbleibenden Unterschiede genügen, um aus Sicht der Menschen sehr verschiedene Lebensformen zu erhalten. Aus bio-logistischer Sicht ist das allerdings Unsinn, denn die Welt besteht zum Großteil aus Gliedertieren - Wirbeltiere haben eine derart untergeordnete Rolle, dass ihr sofortiges Verschwinden keine Auswirkung auf das Gefüge und den Kreislauf des Lebens auf der Erde hätte.
Die Genomgröße allein ist noch kein Maß für die Menge an echter Information in einer Zelle oder einem Lebewesen. Jede Körperzelle eines Hais enthält etwa dieselbe Menge DNA wie die eines Frosches (2x109), während Bohnen- und Molchzellen die zehnfache Menge in sich tragen. Wie kann das sein? Die Erklärung: Weit über 95 Prozent der DNA in komplizierter gebauten Organismen bestehen aus nichtinformationstragenden DNA-Bausteinfolgen (Sequenzen). Diese DNA-Bereiche wurden bis vor wenigen Jahren als junk DNA bezeichnet. Weltweit beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Phänomen. [Anm. d. Redaktion: Unser Autor, Dr. Mark Benecke, gehört dazu!] Viele von ihnen haben ihr wissenschaftliches Leben damit verbracht, die aus ihrer Sicht langweiligeren Gene (d.h. die informationstragende DNA) wegzusortieren und das Geheimnis der nichtkodierenden DNA zu bearbeiten. Sicher ist heute nur, dass (und wie) Gene den Körperaufbau steuern. Es gähnt aber ein gewaltiges Loch scheinbarer DNA-Uninformation, das den meisten Biologen einen ordentlichen Schauer über den Rücken jagt.
DNA - die Geheimschrift des Lebens
Wie sehen all die Rezepte, Karten und Pläne aus, die im Zellkern abgelegt sind? Woraus bestehen sie? Die Antwort: Sie liegen in den langen Molekülfäden, der Erbsubstanzsäure DNA. Auf diesen Fäden befinden sich nicht nur die Bauanleitungen für den Körperaufbau, sondern auch für Altern und Sterben. Die Eigenschaften des Körpers, zum Beispiel Augenfarbe oder die Form der Nase, können durch den Informationsfaden von den Eltern auf die Kinder übertragen, also vererbt werden. Der chemische Name der Säure ist kompliziert. Er lautet deoxyribonucleic acid, zu deutsch: Desoxyribonucleinsäure. Weil Wissenschaftler ebenso bequem sind wie alle anderen Menschen, und weil in den Naturwissenschaften meist englisch gesprochen wird, kürzen sie den englischen Namen ab, indem sie die drei Buchstaben DNA aus dem Wortungetüm heraussuchen und aneinander setzen. Der ausgeschriebener chemischer Name der DNA hört sich exotisch an, und er erinnert ein wenig an malerische Indianerwörter: übersetzt heißt er “Saurer Zucker aus dem Kern der Zelle, der zu wenig Sauerstoff hat”.
DNA ist also eine Säure, ähnlich wie die in Zitronen oder Essig, aber sie ist viel komplizierter zusammengesetzt. Im Zitronensaft schwimmen Zitronensäurebausteine in Wasser herum. Entzieht man dem Saft das Wasser, zum Beispiel durch Erhitzen, lagern sich die Bausteine zu einem hübschen Kristall zusammen. Solche Kristalle mögen gut schmecken und in der Sonne glitzern, aber sie sind auch einfältig. In ihnen kann keine Information gespeichert oder verschlüsselt sein, weil sie aus lauter gleichen Untereinheiten bestehen. Es ist ähnlich wie beim Schreiben, der menschlichen Art der Informationsübermittlung: Man kann viele gleiche Buchstaben, zum Beispiel “E's' oder “A's”, aneinander reihen: Ein Wort oder ein Satz kommt dabei nie heraus.
Der DNA-Faden einer Zelle besteht aus vier verschiedenen Arten von Säurebausteinen. Mit ihnen lassen sich Informationen verschlüsseln und speichern, genauso wie wir es beim Schreiben durch Buchstabenkombinationen tun: Die vier Bausteine des Informationsfadens sind in Dreiergruppen hintereinander angeordnet, bilden also gewissermaßen lauter Wörter aus drei Buchstaben. Lesemoleküle der Zelle nehmen sich dann der Reihe nach jede Dreiergruppe vor und übersetzen sie in einen Zellbaustein. Es gibt vierundsechzig Dreiergruppen oder "Wörter", von denen einige allerdings dieselbe Bedeutung haben. Mit ihnen sind alle Bau- Arbeitspläne der Zellen geschrieben. Ein bildhaftes Beispiel: Die vier Säurebausteine (“Buchstaben” oder Basen) heißen abgekürzt A (für Adenin), C (für Cytosin), G (für Guanin), und T (für Thymin). Angenommen, ein Stückchen eines solchen Informationsfadens besteht aus der erfundenen Reihenfolge CCCGTTAAG. Sehr stark vereinfacht gesagt, erkennt der Leseapparat: CCC = Fett. GTT = am. AAG = Fuß. Heraus kommt also: Fett am Fuß. (Dieses Beispiel ist sehr bildhaft und nicht streng wissenschaftlich zu verstehen.). Die übersetzten Dreiergruppen ergeben in Wirklichkeit natürlich keine Worte, wie sie in diesem Buch stehen. Die Zelle benutzt statt dessen Moleküle. Das macht aber eigentlich keinen Unterschied. Fett könnte wirklich entstehen, wenn auch nicht genau wie im angeführten Beispiel.
Es sind einige molekulare Umwege nötig, und die Zelle braucht dazu eine Kette von mindestens zehntausend "Buchstaben" (das sind ungefähr dreißig Druckseiten eines Buches). Die meisten Anleitungen sind noch viel länger: Sie enthalten oft sehr lange Bereiche mit wirren Zeichenkombinationen, die der Leseapparat nicht versteht und durch besondere Mechanismen "überspringen" muss. Die Übersetzung der Anweisung in der DNA kann heutzutage schon jeder Schüler durchführen. Dazu nimmt man eine Zelle, bringt sie zum Platzen, zieht den Informationsfaden heraus, indem man Alkohol zugibt, und steckt den Faden in ein Plastikröhrchen mit einer Salzlösung. Das Röhrchen kommt in einen Apparat, der gerade halb so groß ist wie eine Waschmaschine. Das Gerät erkennt die "Buchstaben" A, C, G und T, und druckt sie der Reihe nach aus. Steckt man das Röhrchen abends in diese Maschine, so ist am nächsten Morgen eine Seite mit einer Unmenge von C's, G's, A's und T's fertiggestellt. Wenn man Lust hat, kann man die Dreiergruppen nun selbst lesen. (Im Normalfall überlässt man diese Arbeit jedoch einem Computerprogramm. Es übersetzt oft genauer und stets schneller als ein Mensch.).
Obwohl die Geheimschrift der Zelle beeindruckend ist, sollte uns die dahintersteckende Idee vertraut sein: Auch Menschen verschlüsseln jeden Tag Dinge in einem Code aus Buchstaben. Dass es wirklich ein Code ist, merkt man daran, dass nicht jeder ihn versteht. Das Wort líomóid bedeutet Zitrone. Im Westen Irlands würde jeder wissen, was gemeint ist; der Sprachcode ist dort eben anders als hier. Eine auf den ersten Blick ebenso fremde Sprache sind die A's, G's, C's und T's des Informationsfadens. Es dauerte lange, sie entschlüsselt waren. Heute gibt es ein Wörterbuch für die Zellsprache, genannt Codonsonne, weil die Dreiergruppen aus Säurebausteinen “Codons” genannt werden, und weil das Schema mit etwas Phantasie wie die Sonne aussieht. Die Übersetzungsregeln der Codonsonne sind sehr einfach. Der Grundsatz: “Je einfacher, desto besser” gilt in der Natur genauso wie im Alltag. Je einfacher und eleganter etwas aufgebaut ist, desto besser funktioniert es.
Klonen, was ist das?
Bizarre Meldungen in Zeitungen über angebliche Wirbeltierklone beruhen auf einem Sprachirrtum: deutsche Biologen und Mediziner sprechen häufig vom “Klonieren”, womit sie etwas völlig anderes meinen als viele Boulevardjournalisten mit “Klonen”. Leider ist im Englischen nur ein Begriff für beide Tätigkeiten bekannt, “to clone”; bei deutschen Übersetzungen in der Tagespresse wird daher häufig nicht auseinandergehalten, was nun kloniert und was geklont wurde. Was ist der Unterschied zwischen Klonen und Klonieren, und was ist daran überhaupt so wichtig? Wissenschaftler denken beim Klonieren an Stücke des Informationsfadens, die sie in Bakterien einbauen. Die Bakterien teilen und vermehren sich sehr schnell. Mit ihnen vervielfältigt sich das eingebaute Informationsstückchen, beispielsweise die Bauanleitung für die Herstellung von Insulin.
Der erste, der im Reagenzglas künstlich DNA vervielfältigte, war Arthur Kornberg. Er hatte 1956 ein Molekül entdeckt, das DNA-Bausteine zu einem Erbsubstanzfaden verknüpfen konnte. Dafür erhielt er 1959 den Nobelpreis, und acht Jahre später stellte seine Arbeitsgruppe an der Universität Stanford tatsächlich erstmals DNA her, die in Lebewesen funktionierte. Heute macht man es sich einfacher, indem den Bakterien die gewünschte DNA einfach untergeschoben (das heißt, in die Bakterien-Erbsubstanz eingebaut) wird und das betreffende DNA-Stück von der lebenden Bakterienzelle beliebig oft kopieren lässt. Diesen Vorgang nennen Genetiker “Klonieren”. Wenn das Klonieren gelingt, befinden sich die Forscher heute meist auf dem Weg zu einem neuen Medikament oder zu neuen Obst-, Gemüse- und Pflanzensorten.
Das Wort Klonen hat eine völlig andere Bedeutung. Klonieren bedeutet, wie oben beschrieben, DNA-Stücke in Bakterien einzubauen. Klonen ist hingegen die Schöpfung identischer Lebewesen. Dazu entnimmt man die Erbsubstanz aus einer beliebigen Zelle und gibt sie in eine zuvor entkernte Eizelle. Die Eizelle teilt sich, benutzt beim Körperaufbau aber die fremde Erbinformation, die sich nicht durch sexuelle Kombination verändert hat. Echte menschliche Kopien von sich selbst oder anderen Menschen herzustellen ist daher technisch möglich. Obwohl die kopierten Körper aber gleich aussähen, wären deren Geister voneinander verschieden. Es ist unmöglich, einen Stellvertreter zu bauen, der einem sterbenden oder toten Menschen völlig gleicht und ihn ersetzen kann, weil zwei biologisch gleiche Klone, die zu verschiedenen Zeiten aufwachsen, charakterlich unterschiedliche Menschen werden.
Übrigens: Es wird keinen verrückten Diktator geben, der in Zukunft Menschen zum späteren Einsatz als Kämpfer klonen wird. Das ist viel zu aufwendig, vor allem zu teuer. Unfruchtbare Ehepaare, Alleinstehende mit Wunsch nach ihnen genetisch verwandten Kindern, homosexuelle Paare oder Eltern mit Krankheiten, die nur über die Mitochondrien vererbt werden, dürften die Kunden sein, die eines Tages - wenn überhaupt - das Angebot einer biomedizinischen Firma annehmen und irgendwo auf der Erde ihren eigenen Klon zur Welt bringen. In Zukunft werden möglicherweise einige Menschen in wohlhabenden Industrieländern von Krankheiten befreit, bei denen eines ihrer Gene ausgefallen ist. Diesen Menschen wird anstelle des beschädigten ein gesundes, kloniertes Informationsstückchen eingebaut. Die Grundidee dieses biomedizinischen Arbeitsgebiets ist recht einfach.
Um die Erbsubstanz bereits vorhandener Zellen (zum Beispiel bei einem Jugendlichen oder Erwachsenen mit einer erblichen Erkrankung) zu verändern, muss eine verbesserte Version des krankmachenden DNA-Bereiches in den Körper eingeschleust werden. Das Problem: Ein ausgewachsener Körper besteht aus Billionen von Zellen. Von diesen müssen, wenn nicht alle, so doch sehr viele verändert werden. Wie soll das gelingen, wo doch jede einzelne Zelle mikroskopisch klein ist? Eine einzelne Eizelle kann man in einen entsprechenden Apparat legen, mit einer sehr dünnen Glasnadel in sie hineinstechen usw. Man kann aber einer Lunge, die aus kranken Zellen besteht, nicht jede einzelne Zelle entnehmen, diese verändern und anschließend zurücksetzen.
Der Ausweg aus diesem Dilemma sind winzige biologische "Nadeln": Viren. Die gewünschte Erbinformation wird in sie eingespeist; sie wird außerhalb des Körpers gezüchtet und schließlich in den erkrankten Körper gebracht. Dort tragen sie die neue Erbinformation in die erkrankten Zellen. Ein Virus ist ein Wesen, das weder lebt noch tot ist und aus nichts als einem Stückchen Erbsubstanz und einer Proteinhülle besteht. Manche Viren haben einen Bereich auf ihrer Hülle, der dem Andocken an eine Zelle und dem Einspritzen der Virus-DNA dient. Andere Viren haben so etwas nicht, funktionieren aber trotzdem.
Virusforscher schneiden aus dem DNA-Faden eines Virus alle für sie (die Forscher) unnötigen Teile heraus und ersetzen diese durch "gesunde" Erbinformationen, die "kranke" Erbinformationen eines lebenden Menschen ersetzen sollen.
Eine Traumvorstellung wäre es, die Viren mit etwas Flüssigkeit in ein Zerstäuberfläschchen füllen zu können. Der Kranke könnte den Mund öffnen, auf den Zerstäuber drücken und die Viren tief einatmen. Auf diese Weise gelangten die Bionädelchen an den Ort ihres Wirkens, hier die Lunge. Sie befallen die Lungenzellen und spritzen die "gesunde" DNA hinein.
Diese neue Erbinformation wird von den Lungenzellen erkannt und in Proteine übersetzt. Stellte die Lunge zuvor eine Substanz nicht her, so könnte sie diese nun dank der neuen Information bilden. Vorstufen dieser Methode funktionieren bereits - sie heißen somatische (= körperliche, im Gegensatz zur Keimbahn-) Gentherapie. Sie war in Deutschland von Anfang an erstaunlich wenig umstritten, denn sie kann zur Therapie vieler Krankheiten beitragen, die mit den herkömmlichen Methoden nicht heilbar wären. Die Gentherapie ist heute schon in Ansätzen möglich und wird in Nordamerika bei manchen Krankheiten auch schon durchgeführt. Sie ist aber sehr teuer, höchst aufwendig und nicht immer erfolgreich.
Die erste Gentherapie
Die erste Gentherapie wurde ab dem 14. September 1990 an der vierjährigen Ashanti DeSilva am National Institute of Health im US-amerikanischen Bethesda vorgenommen. Ashanti leidet an einer Immunschwäche, die durch ein Stück veränderter DNA in ihren Zellen ausgelöst wird. Diese spezielle Immunschwäche (“Schwere kombinierte Immunschwäche”, SCID) hat im Gegensatz zur Immunkrankheit AIDS nichts mit Viren zu tun, sondern ist im Erbgut festgeschrieben. Die SCID-Patienten müssen abgeschlossen in einem Plastikzelt im Krankenhaus leben, damit jeder Kontakt mit Krankheitserregern vermieden wird. Vor der Einführung der Gentherapie war ein Junge namens David der älteste Überlebende von SCID: In einer Plastikblase im Baylor College of Medicine in Houston verbrachte er zwölf Jahre. Bei einer Knochenmarksübertragung, die David heilen sollte, steckte ein Herpesvirus den Kleinen an und tötete ihn.
In Ashantis Fall kam es anders. Die Professoren French Anderson und Michael Blaese brachten unschädliche Viren in ihre Blutbahn. Die Viren befielen weiße Blutzellen und spritzten in diese insgesamt einige Millionen mal ein Stück Erbsubstanz ein, das bei Ashanti verändert war und die Krankheit verursachte. Die Behandlung war erfolgreich. Ashanti kann mit ihren Freundinnen und Freunden außerhalb des Krankenhauses spielen und zur Schule gehen. Da die weißen Blutzellen die neue Erbinformation jedoch leicht verlieren, muss die Genbehandlung ständig wiederholt werden.
Praktische Probleme von Gentherapien
Trotz erster Erfolge in den letzten Jahren ist die Gentherapie noch nicht ausgereift. Das liegt unter anderem daran, dass es Tausende von Krankheiten gibt, die von einem einzelnen veränderten Gen ausgelöst werden. Selbst eine kleinere Gentherapie kostet zur Zeit noch zehntausende Euro, und es stellt sich aus Kostengründen die Frage, welche erblichen Krankheiten man auf diese Art behandeln kann und möchte und welche nicht. (Derzeit werden Testprogramme durchgeführt, so dass sie die wenigen Patienten nichts kosten. Das wird sich aber bei einer breiten Einführung der Methode ändern.)
Die Heilungsmöglichkeiten durch die gezielte Veränderung des Erbgutes sind nicht allein durch die hohen Entwicklungs- und Behandlungskosten eingeschränkt. Ein wichtiges Problem ist auch die noch äußerst geringe Erfolgsquote der Behandlung. In der Regel muss die teure Behandlung sehr häufig wiederholt werden, bis sie anschlägt, oder um die Wirkung der Therapie aufrechtzuerhalten.
Eine weitere Hürde ist das Verhalten der Kranken bzw. der möglicherweise zukünftig Kranken. Dazu ein Beispiel: Die Klinik der Vanderbilt-Universität hatte den Einwohnern der US-amerikanischen Stadt Nashville im Jahr 1996 einen kostenlosen Gentest angeboten.
Mit diesem Test konnte sie ermitteln, ob Erwachsene eine relativ häufige genetische Veränderung in sich tragen, die erst bei ihrem Kind ausbrechen würde. Die Krankheit, die diese Kinder dann bekommen (Cystische Fibrose, CF; auch Mukoviszidose genannt), ist quälend und tödlich, unter anderem weil sie zu einer stark verschleimten Lunge führt. Von den Hunderttausenden von Menschen, die mit Flugzetteln und Postern angesprochen wurden, meldeten nur gut zweihundert ihr Interesse an. Zwei Drittel der gleichzeitig befragten Amerikanerinnen und Amerikanern gab an, dass sie Angst davor hätten, bei einem positiven Testergebnis aus der Krankenversicherung ausgeschlossen zu werden. Doch selbst unter den wenigen anfangs Interessierten gab es noch viele Ausfälle: Als sie erfuhren, dass ihnen für den Test ein Tropfen Blut aus dem Finger entnommen werden sollte, sprang ein Viertel der Probanden ab.
Lebensdauer von Zellen
Lange glaubte man, dass Zellen einfach sterben, weil sie nach einiger Zeit zu viele Abfallstoffe in sich tragen. Zell-Abfallstoffe entstehen durch Atmung, Verdauung und Bewegung. Diese Vorgänge benötigen Energie und Energieerzeugung verursacht Abfall. Was den Atomkraftwerken die alten Brennstäbe, sind den Zellen unverwertbare winzigste Nahrungsbestandteile. Solche Nahrungsteile werden - ganz ähnlich wie verbrauchte Brennstäbe - sicherheitshalber umhüllt. Die Zelle kann den giftigen Müll oft nicht ausstoßen, deshalb bleibt er in ihr liegen. Es ist durchaus vorstellbar, dass die Zelle sich auf diese Weise langsam selbst vergiftet, bis sie stirbt. Diese Idee soll im 16. Jahrhundert schon der streitbare Arzt Philippus Theophrastus Paracelsus vorgetragen haben. Ende des neunzehnten Jahrhunderts wiederholte sie der Zellbiologe Elias Metschnikow. Biologen wundern sich allerdings ein wenig über das (gewollte?) Vergiftungsmissgeschick der Zellen.
Die berühmten Biologen Charles Darwin und August Weisman gingen Ende des neunzehnten Jahrhunderts davon aus, dass sich eine Zelle ähnlich wie eine Maschine "abnutzt". Dass der Vergleich mit einer Maschine hinkt, zeigt aber schon das Beispiel eines Muskels, der sich bei Nichtbenutzung, etwa im Gipsverband, zurückbildet. Eine Maschine würde so etwas nicht tun. Wenn eine Zelle sich schon wie eine Maschine verhalten soll, dann muss sie alle oder zumindest viele maschinenähnliche Eigenschaften zeigen und nicht bloß eine einzelne wie die Abnutzung.
Eine wesentlich elegantere Erklärung für den Tod der Zellen fanden die Forscher schließlich auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert, als sie eine Blutzelle in einem Glasschälchen züchten wollten. Sie setzten eine junge, lebendige Zelle in einen Flüssigkeitstropfen, stellten eine für das Wachstum günstige Temperatur ein, gaben Nährstoffe zu und sorgten für Sauerstoff zum Atmen. Die Zelle starb. Daraufhin verbesserten die Wissenschaftler die Lebensbedingungen der Zelle. Sie füllten eine Glasschale mit einem Gelee aus gekochten Algenzutaten und setzten darauf die Zelle. Nichts geschah. Sie gaben recht wahllos weitere Nahrungsstoffe zu. Nun überlebte die Zelle. Sie entwickelte sich aber nicht weiter. Da kam einer der Forscher auf die Idee, dem Nährboden Blutserum zuzusetzen - das Serum ist der Teil des Blutes, der nach Entnahme der roten Blutkörperchen übrigbleibt. Von da an gedieh die Zelle hervorragend, das heißt, sie vermehrte sich. Eine in Kultur gehaltene Mauszelle zum Beispiel teilte sich in geeigneter Umgebung bis zu zwanzigmal. Warum, konnte sich zunächst niemand erklären. Es fiel jedoch auf, dass die Zellen sich bei Zugabe von einem Prozent Serum nicht so oft teilten wie bei einem Serumanteil von zehn Prozent. Das Serum musste das entscheidende Geheimnis des Wachstums und der Zellteilung in sich bergen.
Zur gleichen Zeit hatte der Chirurg, Zellkulturspezialist und Nobelpreisträger Alexis Carrel zusammen mit seinem Kollegen Albert Ebeling vom Rockefeller-Institut für Medizinische Forschung in New York Bindegewebszellen (Fibroblasten) aus einem Hühnerherz in körperwarmer Nährlösung am Leben erhalten. (Hühnchen - vorwiegend sehr frühe, ungeschlüpfte Entwicklungsstadien - benutzt man immer noch gerne als Ausgangsmaterial, unter anderem, weil Hühnereier leicht zu bebrüten und die Embryonen im vorsichtig geöffneten Ei gut untersuchbar sind. Carrels Kultur hielt sich sehr lange. Erst nach vierunddreißig Jahren vernichteten die Forscher die Schalen mit der immer noch lebenden Zellkultur.
Ursprünglich hatte sich Carrel vor allem für die Lagerung von Geweben (und nicht für ihre Züchtung) interessiert. Als der Chirurg einem Hund ein “fingerlanges Stück” der Bauchschlagader durch ein ebenso langes Stück einer Katzenvene ersetzte, benutzte er erstmals Gewebe, das zwanzig Tage auf Eis gelegen hatte. Die Operation gelang, und die Ader heilte ein. Nun wurde Carrel mutiger. Er wusste, dass sein Kollege Wentscher schon 1894 Haut übertragen hatte, die fünfzig Tage auf Eis gelegen hatte. Auch Leo Loeb hatte schon 1898 Stückchen von Haut und Krebsgewebe in Reagenzgläsern mit Lymphe und Blutplasma gehalten, und einen Versuch des Mediziners Ljungren, der Haut einen Monat außerhalb des Körpers aufbewahrt hatte, bewunderte Carrel besonders. Als dann die ersten Organübertragungen des Forschers Garrè bekannt wurden, gab es für Carrel kein Halten mehr. Was ihm mit Adern gelungen war, musste auch mit größeren, sogar viel größeren Gewebestücken gelingen.
Zusammen mit seinem Kollegen Guthrie brachte er es schließlich so weit, dass er einem Tier beide Nieren mit der zuführenden Bauchschlagader, der abführenden Hohlvene, dem Harnleiter und der Harnblase entnehmen und einem anderen Tier erfolgreich und dauerhaft einsetzen konnte. Aber auch mit diesem Kunststück war Carell noch nicht zufrieden. Er tat sich mit seinem Kollegen Burrows zusammen und verbesserte einen Versuchsaufbau des Amerikaners Ross Granville Harrison, der im Jahr 1907 Gewebestückchen von Fröschen in eine Nährlösung getaucht und zur Weiterentwicklung gebracht hatte. Harrison, damals Forscher an der amerikanischen Universität Yale, war damit der Erfinder der Gewebezüchtung. Carrel übertraf ihn jedoch, vor allem wegen seiner unermüdlichen Ausdauer.
"Also", beschrieb Herman Dekker 1913 das Zuchtverfahren, "verfährt Carrel so: Von dem Gewebe wird ein kleines Stückchen von 1/10-1/2 mm Durchmesser, sagen wir von Stecknadelkopfgröße, auf ein Deckgläschen gebracht und mit dem präparierten frischen Plasma [Blutflüssigkeit ohne Blutkörperchen] bedeckt. Sofort wird dieses Deckgläschen, die Kultur nach unten, mit Paraffin auf einen hohlgeschliffenen Objektträger gekittet (um die Kultur feucht zu erhalten), und in einen Brutschrank gebracht. In diesem "hängenden Tropfen" geht das Wachstum vor sich. Die ganze Prozedur erfordert rasches Handeln, ist das Werk von Augenblicken, damit das Gewebe nicht geschädigt wird und um den Zutritt von Keimen zu verhindern. Carrel und Burrows haben seit dem Jahre 1910 auf diese Weise fast alle Gewebe von Erwachsenen, von Hund, Katze, Ratte, Kaninchen, Huhn, außerdem Krebszellen vom Menschen kultiviert."
Innerhalb von zwei Jahren wurde weltweit in allen großen Zeitungen über Carells Versuche berichtet. Meist wurden die Experimente jedoch missdeutet: Aus den stecknadelkopfgroßen Gewebestücken wurden lebende Arme und Beine, die angeblich in Kulturen schwammen. Den wirklichen Wert der Gewebezüchtung, die eines Tages die molekulare Zellforschung ermöglichen würde, konnte damals noch niemand erkennen. “Die Forscher sind so närrische Käuze”, schrieb Herman Dekker, “dass sie zunächst gar nicht nach dem praktischen Wert ihrer Forschungen fragen. Es genügt ihnen, wenn ihnen im stillen Laboratorium der Kopf heiß und das Herz warm wird in der großen Freude über die stillen Erfolge ihrer Arbeit.”
Ein ähnliches Sprachmissverständnis wie bei der “Gewebezüchtung” liegt wohl auch dem Bericht zugrunde, wonach der russische Forscher Krakow, ebenfalls zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, das Ohr eines Kaninchens und einen menschlichen Finger über die Zeit gerettet haben soll, indem er sie trocknete und angeblich später in Wasserdampf “zum Leben” erweckte. Zwischen 1940 und 1960 wurde die Gewebekultur von der Spielerei einzelner zur Chefsache. Mittlerweile war bekannt, dass die kleinsten Vorgänge in den Zellen die Grundlage das Lebens darstellen. Diese Stoffwechselabläufe wollten Biologinnen und Biologen nun enträtseln. Deshalb begannen sehr viele Labors damit, Zellkulturen als Ausgangsmaterial für ihre Forschungen zu züchten.
Anfang der sechziger Jahren beobachtete Professor Leonard Hayflick, dass sich Bindegewebszellen in Schalen ungefähr fünfzigmal teilen (mindestens vierzig- und höchstens sechzigmal). Kurz vor Ende dieses Teilungsprozesses beginnt das sogenannte “Phase-3-Phänomen”: Die Zellen teilen sich zuletzt immer langsamer (Alter) und sterben schließlich (Tod). In den Phasen Eins und Zwei wachsen die Zellen mit gleichbleibender Geschwindigkeit heran - wenn man sie lässt. Sobald normale Zellen nämlich die Oberfläche ihrer Wachstumsschale mit einer einlagigen Schicht bedecken, beenden sie ihr Wachstum vorläufig. Krebszellen vermehren sich hingegen munter weiter. Solche unbegrenzt vermehrungsfähigen Zellen - zwei bekannte Typen tragen die Bezeichnungen “Hela” und “L” - waren jahrzehntelang die Objekte, an denen die Krebsforschung stattfand. “Unsterbliche Zellen wie Hela und L”, sagte Professor Hayflick schon in den sechziger Jahren voraus, “haben eine oder mehrere anomale Eigenschaften.” Daraus ergab sich eine wichtige Erkenntnis: Wenn man erst einmal alle anormalen Eigenschaften vollständig kennt, wird man die Krebsentstehung ein für allemal verstehen. Vielleicht können dann vorbeugende Maßnahmen entwickelt werden, um Krebserkrankungen endgültig zu verhindern.
Das war auch Leonard Hayflick von Anfang an klar. Um die Zellen möglichst lange benutzen zu können, züchtete er die sterbliche Linie WI-38 heran, die er in viele kleine Portionen teilte und seit 1962 in flüssigem Stickstoff bei minus 192 Grad Celsius aufbewahrte. Zugleich konnte Hayflick seine Zellen auf diese Weise an seine Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Welt versenden, wann immer sie dies wünschten. (Es ist unter Wissenschaftlern üblich, Proben stets kostenlos auszutauschen.) Während WI-38 in den siebziger Jahren zur bestuntersuchten lebenden Zelleinheit der Erde wurde, fiel Hayflick etwas Erstaunliches auf. Trotz ihres Eisschlafes konnten die Zellen sich merken, wie oft sie sich vor dem Einfrieren geteilt hatten. Taute man die Zellen auf, so machten sie nur noch genau so viele Teilungen durch, wie sie es auch unter normalen Bedingungen getan hätten. Es gibt also einen Zähl- und Speichermechanismus, der die Zellteilungen festhält. Ein solches inneres Zählwerk hatte man zwar in den Zellen erwartet, aber dass die Zelluhr so lange funktioniert, war eine Überraschung. Hayflick bestätigte 1990 stolz: “Wir haben in den letzten achtundzwanzig Jahren aus hundertdreißig Gefäßen wieder Zellen aufgetaut. Ihr Gedächtnis ist noch genauso gut wie 1962.”
Dieses Zellgedächtnis funktioniert auch bei Zellen, die aus einem lebenden Körper stammen. Je älter ein Mensch zum Zeitpunkt der Zellentnahme ist, desto geringer ist die Zahl der Zellteilungen in der daraus hergestellten Kultur. Nun wissen wir aber, dass sich die vielen Zellen eines Menschen im Laufe seines Lebens mehrmals komplett erneuern. Die innere Uhr tickt also nicht nur in jeder einzelnen Zelle und zählt deren Teilungen. Jede Zelle muss schon bei ihrer Entstehung darüber informiert sein, wie alt der übrige Körper ist.
Jede Zelle des Körpers geht aus einer anderen, meist gleichartigen Zelle hervor. Wir können also annehmen, dass die Information über den Zustand des Körpers, in dem die Zellen leben, beim zellulären Schichtwechsel weitergegeben wird. Wie das im einzelnen passiert, ist noch unbekannt. Einige Zellzählwerke und -uhren sind mittlerweile entdeckt worden. Niemand weiß aber, welche molekulare Uhr zu welchem Ereignis, zum Beispiel zur Zählung der Zellteilungen, gehört.
Je älter ein Mensch ist, desto seltener können sich seine Zellen in einer künstlichen Kultur teilen. Gilt diese Regel für alle Zellen? Soweit es Zellen aus einem gesunden Körper sind, lautet die Antwort ja. Wie steht es aber mit Zellen von Menschen, die zu früh altern? Zwei Krankheiten, bei denen eine stark verfrühte Vergreisung eintritt, sind die Progerie und das Werner-Syndrom. Kinder mit Progerie sehen bereits mit neun Jahren aus wie Siebzigjährige, bei Patienten mit dem Werner-Syndrom setzt der körperliche Verfall einschließlich Arterienverkalkung, brüchigen Knochen und einem Hang zu Zuckerkrankheit etwas später ein. Man hat ausgerechnet, dass die Zellen in Gewebeteilen eines mit dem Werner-Syndrom geborenen Menschen sich in Kultur höchstens noch etwa zwanzig- bis vierzigmal teilen müssten.
Hayflicks Kollege Goldstein fand diese Frage besonders spannend und machte, wie es in den Naturwissenschaften üblich ist, die Probe aufs Exempel. Die Werner-Zellen teilten sich in Wirklichkeit nur noch höchstens achtzehnmal. Auch in dieser Untersuchung zeigte sich, dass das Altern der Werner-Kinder schneller als erwartet voranschritt. Mittlerweile weiß man mehr über die fürchterliche Erkrankung, und vielleicht gelingt es dadurch bald, die betroffenen Kinder von ihrem unverschuldeten Leid zu befreien.
Anfangs war es nur schwer vorstellbar, dass die Entwicklung einer Zelle von einer so aberwitzig geringen Stoffmenge wie einigen Tropfen Blutserum abhängen sollte. Wie sich später zeigte, entscheiden noch nicht einmal alle Zutaten der Tropfen, sondern nur einzelne Bestandteile aus ihnen über Teilung oder Nichtteilung. Die guten Geister bei der Weiterentwicklung von Gewebekulturen, so stellte sich heraus, waren sogenannte Wachstumsfaktoren. Ihre enge Verknüpfung mit der Zellteilung kommt dadurch zustande, dass sie das Signal für viele Abläufe geben, die vor der eigentlichen Verdopplung ablaufen. Fehlt ein Wachstumsfaktor als Informationsempfänger und -übermittler, so bleibt die Zelle in ihrem Wachstum stecken. Dann nützt es auch nichts mehr, wenn die äußeren Bedingungen (etwa das Nahrungsangebot oder Befehle anderer Zellen) eine Zellteilung wünschenswert oder zwingend machen. Wenn die Information versackt, erfahren die übrigen Zellbestandteile nicht, dass sie nun gefordert sind. So kommt es auch, dass man Zellen in wachtumsfaktorfreier Zellkultur wochenlang halten kann, ohne dass sie sich teilen. Die Zellen finden dann alle Nährstoffe vor und "fühlen sich wohl", sie können aber nicht an ihre innere Schaltzentrale melden, dass der Zeitpunkt für Wachstum und Teilung gekommen ist.
Wachstumsfaktoren sind Proteine; jeder von ihnen wirkt nur auf bestimmte Zelltypen, und jede Zellart benötigt eine genau auf sie abgestimmte Zusammensetzung von Wachstumsfaktoren. Der Körper stellt an festgelegten Orten spezielle Wachstumsfaktoren zu bestimmten Zeiten her. Dort liegen Zelltypen, die für eine Sorte von Wachstumsfaktoren empfänglich sind und sich an dieser Stelle vermehren beziehungsweise verändern sollen. Wie gering der Bedarf an Wachstumsfaktoren tatsächlich ist, zeigt das sogenannte Zuckerdosenbeispiel. Man wirft einen Zuckerwürfel ins Meer und nimmt an, dass sich der gelöste Zucker auf alle Meere der Erde verteilt. Man kann dann aus jedem Meer der Welt eine Tasse Wasser schöpfen und findet darin noch zwei Moleküle des ursprünglichen Würfelchens. In diesen Größenordnungen liegen auch die Mengen von Wachstumsfaktoren, die von den Zellen genutzt werden.
Alterung von Zellen und Lebewesen
Im halbmillimetergroßen Fadenwurm Caenorhabditis elegans, aber auch in der Taufliege Drosophila melanogaster konnten Genetikerinnen und Genetiker bereits mehrere Gene finden, die gezielt Zellen des eigenen Körpers umbringen. Besonders berühmt sind zwei Selbstmordgene namens ced-3 und ced-4, die in jeder Körperzelle des Fadenwurms stecken. Während der junge Fadenwurm heranwächst, sterben in ihm bestimmte Zellen zu vorhersagbaren Zeitpunkten ab. Dies ist wenig dramatisch - derselbe Vorgang findet statt, wenn sich Menschenfinger bilden. Ohne programmierten Zelltod würden sich zwischen unseren Fingern Schwimmhäute spannen.
Wenn man die beiden Selbstmordgene im Wurm ausschaltet (dies ist heute möglich), dann überleben sämtliche Zellen, darunter auch solche, die bei der Normalentwicklung sterben, um Raum für neu entstehende Organe zu schaffen. Ganz ähnliche Gene gibt es in den Zellkernen der Säugetiere und Menschen gibt es sehr ähnliche Gene. Besonders erwähnenswert sind sogenannte Überlebensgene wie das Gen p53. Sie verhindern den programmierten Zelltod, ohne dass Todesgene ausgeschaltet werden müssten.
Manche Entwicklungsgenetikerinnen und -genetiker denken schon heute laut darüber nach, Medikamente zu entwickeln, die Todesgene beeinflussen. Dieser Vision sind zumindest Taufliegen- und Fadenwurmforscher schon recht nahe. So gelang es Thomas Johnson an der Universität Colorado Anfang der neunziger Jahre, ein Todesgen des Fadenwurms auszuschalten und die Lebenszeit der Tiere dadurch zu verdoppeln.In der Taufliege wurde kürzlich ein Gen namens reaper (Sensenmann) entdeckt, das den kontrollierten Zelltod einleitet, sobald eine bestimmte Menge von Todessignalen in die Zelle gelangt. Wird das Sensenmann-Gen ausgeschaltet, so können selbst beschädigte oder kranke Zellen noch weiterleben. Medizinisch (das heißt beim Menschen) wäre so etwas nicht von Nutzen, denn beschädigte Zellen müssen unbedingt aufgelöst werden.
Bessere Kandidaten für eine medizinische Altersvorbeugung könnten andere Todesgene wie der DNA-Abschnitt apo E sein. Mensch hat das Gen zwar noch nie "ausgeschaltet", aber sehr alte Menschen, denen das apo-Gen E4 von Natur aus fehlt, sind besonders gesund und lebensfroh. Niemand kann sich nicht hundertprozentig sicher sein, dass das Fehlen von apo E4 und das Altersglück wirklich zusammengehören. Vergleicht man aber die Ergebnisse psychologischer Tests, die das Wohlbefinden der Menschen prüfen, mit molekularen Tests für das Fehlen von apo E4, scheint sich diese Annahme zu bestätigen.
Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen dem Altern, das strenggenommen ab dem fünfundzwanzigsten Lebensjahr beginnt, und dem Programm unserer Gene, die das Altern vorschreiben. Die Forschung auf diesem Gebiet steckt entgegen der Meldungen der Boulevardpresse aber noch in den Kinderschuhen. Ein Glücksfall schien beispielsweise vor fünf Jahren die Entdeckung des Gens age-1 zu sein. Ist der age-1-Bereich der Fadenwurm-Erbsubstanz defekt, so leben die Tiere bis zu dreimal länger als ihre unmutierten Geschwister - einfach so. Vorhersagbar schielten Marktschreier sofort nach einer lebensverlängernden Gentherapie. Für den Fall, dass Menschen ein ähnliches Gen besitzen, sollten Viren gebaut werden, die im menschlichen Zellkern eine vergleichbare Methusalemisierung bewirken wie beim Wurm.
Die Lehre kam postwendend. Denn seltsamerweise kurbelt das kaputte Wurmgen den Stoffwechsel an; die Enzyme Katalase, Superoxiddismutase, Isozitratdehydrogenase und einige andere finden sich in sogenannten Age-1-Minus-Tieren in höheren Spiegeln als in normalen Tieren. Kurz gesagt, diese Würmer scheinen mehr Protein zu bilden und länger zu leben. Das steht in direktem Gegensatz zu allen bisherigen Befunden, nach denen Tiere immer dann länger leben, wenn sie weniger verstoffwechseln. Mäuse leben länger, wenn sie etwas weniger fressen. Eichhörnchenartige Tupaias, die statt zu wuseln und zu kämpfen lieber friedlich kuscheln, haben ein längeres Leben als ihre aufgekratzten Artgenossen. Und auch die Lebensspanne der Vogelarten, die mehr Energie verbrauchen, ist kürzer als diejenige von Arten mit niedrigerem Energieverbrauch. Daher glaubte man stets an eine biologische Gleichung, die zusammengefasst lautet: Energiereiches Leben gleich schnelleres Altern, oder bildhafter Die hellere Lebenskerze brennt schneller. Age-1 machte den schlauen Satz ungültig.
Und das war nur die erste einer Reihe von scheinbaren Paradoxien auf dem Weg zur Erforschung ewiger Jugend. So bewirkt das Protein Telomerase beim Menschen, dass bei jeder Zellteilung ein Stückchen schützender DNA an den Chromosomenenden weggeknipst wird. Je kürzer die DNA-Schutzkappen werden, desto älter erscheint die Zelle - bis sie schließlich auf Zellselbstmord umschaltet. Ergo: je weniger Erbsubstanz die Zelle birgt, desto näher ist sie dem Tod. Doch ist das eine Grundregel? Nein. In Hefezellen ist es genau umgekehrt. Hier sterben die Zellen, wenn ein kreisförmiges Stückchen ribosomaler DNA ausschert und sich zu oft vermehrt. Die Zelle altert, je mehr DNA sie anhäuft. Das Beste daran ist, dass Hefe- und Menschenzellen sich nicht wie Äpfel zu Birnen verhalten - man kann sie möglicherweise vergleichen.
Es gibt schwache experimentelle Hinweise darauf, dass dieselbe Stoffwechselunterbrechung, die in der Hefe zur katastrophalen DNA-Ringansammlung führt, im Menschen am Werner-Syndrom beteiligt sein könnte. Dabei vergreisen Kinder und sterben in früher Jugend an Alterserscheinungen. Das ist nicht nur ein erster Hinweis auf mögliche Übereinstimmungen im Erbprogramm ganz verschiedener Organismen, sondern zugleich die Route für eine der wichtigsten biomedizinischen Zukunftstechniken.
Anstatt wie früher zuerst den Menschen zu studieren, beginnen Entwicklungsbiologinnen und -biologen ihre Suche nach den Grundregeln der Biologie (und damit auch der Alterungs-DNA) noch einmal ganz von vorne, bei Wesen, die biogeschichtlich lange vor dem Menschen entstanden sind. Entdeckungen zum Verhalten, den Körperformen und der Erbsubstanz von Milliarden wirbelloser Versuchstiere werden schon bald mit denen hunderttausender kleiner Wirbeltiere verglichen und später an wenigen Menschen zur medizinischen Anwendungsreife gebracht. Das spart nicht nur Kosten und menschliche Versuchskaninchen, es beweist auch endlich unwiderruflich den Zusammenhang zwischen allem Lebenden.
Bis die Zukunftsbiologie ihr unfreiwilliges Endziel erreicht und klare Rezepte zur verlängerten Jugend ertüftelt, wird viel Zeit vergehen. Denn bislang gelingt es meist nicht, wie beim Werner-Syndrom, einen Zusammenhang zwischen äußerlich sichtbaren Erscheinungen (Altern) und molekularen Ursachen (DNA-Veränderung) zu konstruieren. Ein Beispiel dafür ist der meist zweigeschlechtliche, manchmal aber auch männliche Fadenwurm Caenorhabditis elegans, der schon bereits erwähnt wurde. Obwohl sein Erbgut seit 1999 von A bis Z durchgelesen (wenn auch noch nicht voll verstanden) ist, rätseln Alterungsforscher über das Vergreisen der Tiere: je öfter die Tiere miteinander kopulieren, desto eher sterben sie. Warum das so sein könnte, scheint nahezuliegen. Mehr Sex bedeutet mehr Spermien und befruchtete Eier - und das kostet Kraft.
Leider ist diese Gedankenkette ebenso einleuchtend wie falsch. Denn auch wenn sich unfruchtbare, spermienlose Tieren paaren, altern sie rascher als jeder sexmuffelige Einzelgängerwurm. Die Produktion von Eiern und Spermien verausgabt die Tiere also nicht - es ist die eigentliche Paarung, die das Leben zu verkürzen scheint. Der Begattungsakt ist beim Fadenwurm aber derart unspektakulär, dass niemand dort eine ernstliche Kräftevergeudung sehen kann. Gibt C. elegans ähnlich wie die Taufliege Drosophila bei der Paarung eine Substanz ab, die lebensverkürzend wirkt? Und wenn ja, warum? Ein weiterer unverstandener Zusammenhang, der erst im neuen Jahrhundert aufgeklärt wird, und von dem sich zeigen muss, ob er auch für Menschen etwas bedeutet.
Genetischer Fingerabdruck
In der Kriminalistik und Rechtsmedizin werden zur Erkennung von Tätern und Tatortspuren, aber auch zur Vaterschaftsbestimmung sehr oft DNA aus dem Zellkern und aus den Mitochondrien benutzt. Die Methode wird oft spaßhaft "genetischer Fingerabdruck" genannt, eigentlich heißt sie aber DNA-Typisierung. Eines haben genetische Fingerabdrücke und echte Fingerabdrücke gemeinsam - sie verraten beide nicht mehr über eine Person als ein Strichcode auf einer Milchpackung. Ein Stichcode dient vor allem dazu, das Produkt so genau zu beschreiben, dass das elektronische Kassensystem es nicht mit einem anderen Produkt verwechselt. Ob die Milch schon sauer ist, oder ob die Packung nur halb voll ist, weiß der Strichcode nicht. Es spielt für die Abrechung und Lagerhaltung auch keine Rolle. Genauso verhält es sich mit einer DNA-Typisierung. Sie soll eine Person eindeutig erkennen, aber ohne ihre Persönlichkeitszüge zu erfassen. Abgesehen davon, dass es für Kriminalbiologinnen und -biologen überflüssig ist, etwas über den Körperbau oder den Geist einer untersuchten Person aus einer Spur abzuleiten, wollen sie solche Überschussinformationen auch aus einem anderen Grund nicht ermitteln. Die biologische Privatsphäre der Untersuchten soll grundsätzlich geschützt bleiben. An dieses Gebot halten sich alle Kriminalbiologen, die der Autor bis heute weltweit getroffen hat.
Eine DNA-Typisierung mit anschließendem Vergleich der Daten (beispielsweise zwischen einer freiwilligen Speichelprobe eines Verdächtigen und einer Tatortspur) wird Identifizierung genannt. Weil es heute gelingt, einen genetischen Fingerabdruck zu erstellen, den nur einen einziger Menschen auf der Erde in sich trägt, spricht man gelegentlich auch von einer Individualisierung. Welche Technik steckt dahinter? Die zugrundeliegende Idee ist wieder einmal recht einfach. Ausgangspunkt der DNA-Typisierung ist das fadenförmige Erbsubstanzmolekül DNA, das recht stabil ist. Ein DNA-Strang besteht aus Basen (Nukleotiden), die an einem molekularen Rückgrat aufgereiht sind. Die Anordnung bzw. Reihenfolge der Basen stellt die Schrift dar, mit der alle Informationen auf der DNA geschrieben werden. Bei Blutspuren gewinnt man die für genetische Fingerabdrücke erforderliche DNA aus den Kernen der weißen Blutzellen.
Sind die zu untersuchenden Personen am Leben (z.B. bei Vaterschaftsuntersuchungen), so genügt es, den Betreffenden einige Milliliter Blut abzunehmen. Auch Leichen oder flüchtige Täter können auf diese Weise typisiert werden, da selbst getrocknete Blutspuren oft noch genügend DNA enthalten. Zur Not genügen bereits Knochen, Haare, Reste von Körpergewebe, eingetrocknetes Sperma oder Vaginalzellen, um genetische Fingerabdrücke herzustellen. Brandleichen können auf diesem Weg identifiziert und - etwa im Fall einer Flugzeugkatastrophe - abgetrennte Gliedmaßen dem dazugehörigen Körper zugeordnet werden.
Der Erbsubstanzfaden, auf dem unter anderem die Bauanleitung für unseren Körper gespeichert ist, besteht zum größten Teil, zu 96 Prozent, aus Information, die bis heute unverstanden ist. Mensch weiß aber, was diese "nichtcodierenden" DNA-Bereiche nicht sind: Gene. Das bedeutet, dass die nichtcodierende DNA weder ein Bauplan für den Körper noch dessen Entwicklung ist. Sie verrät auch nichts über die Psyche oder die Intelligenz einer Person. Da Kriminalbiologinnen und -biologen ohnehin nicht auf dererlei Information abzielen, haben sie im Bereich der nichtcodierenden DNA freie Hand.
Einige nichtcodierende DNA-Abschnitte eignen sich zur Individualisierung eines Menschen, weil sie von Mensch zu Mensch verschieden sind. Es gibt hunderte von DNA-Bereichen, die sich unterscheiden und daher für die kriminalbiologische Anwendung geeignet sind, aber im Laufe der Zeit hat man sich auf ein Standardrepertoire von etwa zwanzig solcher Abschnitte geeinigt. Sie heißen short tandem repeats, weil sie kurz (short) sind und aus einer Grundeinheit bestehen, die sich immer wiederholt (repeat), so wie sich auf einem Tandemfahrrad die Tretkurbel wiederholt.
Selbst, wenn zwei Menschen durch Zufall einige Ähnlichkeiten in diesen DNA-Bereichen aufweisen, so gibt es immer noch genügend andere, in denen sie eindeutig voneinander verschieden sind. Die kriminalbiologisch interessanten DNA-Bereiche haben alle die Eigenart, dass sie in der DNA verschiedener Personen verschieden lang (= variabel) sind. Innerhalb einer Person gibt es keine Längenunterschiede, weil die DNA eines Menschen in allen Körperzellen gleich ist.
Da es sehr umständlich ist, die Längen der variablen Bereiche direkt auszumessen, greifen Forscher im Labor heute zu einer eleganten Biotechnik, die ihrem Erfinder Kary Mullis 1993 den Nobelpreis für Medizin eingebracht hat. Dabei werden die ausgewählten DNA-Bereiche zunächst vervielfältigt. Das ganze funktioniert im Grunde wie ein normaler Fotokopiervorgang, bei dem man einzelne Seiten eines Buches beliebig oft kopiert, ohne den Rest des Buches mitkopieren zu müssen. Die Kopiertechnik im Labor heißt Polymerasekettenreaktion (polymerase chain reaction, PCR).
Der Name entstand durch den Namen des Moleküls, das den Kopiervorgang im Reagiergefäß durchführt, der Polymerase. Eine Kettenreaktion ist die Methode deshalb, weil anders als beim Fotokopieren sehr schnell immer mehr Kopien entstehen, wenn die chemische Reaktion weiterläuft. Aus zwei Kopien werden dabei vier, diese werden wieder kopiert: acht, nächste Kopierrunde: sechzehn und so weiter. Die rasante, exponentielle Vervielfältigung der gewünschten DNA-Abschnitte führt dazu, dass schon nach etwa dreißig Kopierrunden viele Millionen Kopien der kriminalbiologisch interessanten DNA-Abschnitte in einem kleinen Tropfen Flüssigkeit vorliegen. Das bedeutet, dass selbst aus winzigsten Spuren noch genügend DNA für eine Untersuchung zu gewinnen ist.
Die kopierte DNA-Menge ist nun gut handhabbar. Um die Länge der darin enthaltenen Stücke zu messen, gibt man einen Teil der Flüssigkeit (zum Beispiel drei Mikroliter) in eine Vertiefung eines puddingartigen Gels aus Polyacrylamid und setzt es unter Strom. Genauer gesagt, das eine Ende des Gels wird negativ und das andere positiv geladen. Weil DNA selbst negativ ist, wird sie im Gel zum unteren, positiven Pol hingezogen. Nach etwa drei Stunden wird die elektrophoretische Trennung gestoppt. Nun liegen die durchsichtigen DNA-Stücke ihrer Größe nach sortiert im Gel. Die größeren Stücke liegen weiter unten, weil sie mehr negative Ladung tragen und daher stärker zum Pluspol gezogen wurden. Die kleineren Stücke liegen weiter oben, weil sie weniger negative Ladung tragen und daher nicht so stark angezogen wurden. Das Gel wird danach genau wie ein Schwarzweißfoto mit Silbersalzen entwickelt.
Die aufgetrennten DNA-Stücke werden dabei als schwarze Linien oder "Banden" sichtbar. Neben den DNA-Stücken, deren Längen unbekannt sind, lässt man immer auch DNA-Stücke bekannter Länge im Gel mitlaufen. Dann wird verglichen, wie weit die bekannten von den unbekannten Stücken entfernt sind, und so lässt sich deren Größe (in Basenpaaren, bp) sicher berechnen. Eine andere beliebte Methode ist, ein Gemisch aller bisher gefundenen DNA-Abschnitte (Allele) - scherzhaft Allelcocktail genannt - im Gel mitlaufen zu lassen. Weil es nur eine begrenzte Anzahl von kopierbaren Abschnitten gibt, vergleicht man in diesem Fall zur Längenbestimmung einfach die unbekannten Stücke mit denen aus dem Cocktail. Diejenigen Stücke, die auf derselben Höhe im Gel liegen, haben dieselbe Länge. Da die Längen der Cocktailstücke bekannt sind, braucht nicht einmal mehr gerechnet werden. Beide Längenmessmethoden sind sehr präzise, und es hängt vorwiegend von der Philosophie eines Labors oder den Vorschriften des jeweiligen Landes ab, welche Methode in der täglichen Praxis eingesetzt wird.
Wissenswertes und Amüsantes aus Dr. Beneckes Grabbelkiste
Das Zuckerdosenbeispiel
Glauben Sie Dr. Beneckes Beispiel mit der Zuckerdose? Hier ist meine Rechnung: Ein Zuckerwürfel wiegt drei Gramm, das entspricht 1022 Zuckermolekülen (Zuckerteilchen). Die Meere enthalten insgesamt 1021 Liter Wasser. Das verrührte Würfelchen ergibt für jeden Liter Meerwasser zehn und damit pro Tasse zwei Zuckerteilchen. Aus einem 1933 gehaltenen Vortrag des deutschen Chemikers Otto Hahn, dem Mitentdecker der Kernspaltung, stammt ein weiterer schöner Vergleich, der die Größenordnungen in der Botenstoff- und Teilchenwelt veranschaulicht: “Stellen Sie sich eine gewöhnliche Glühbirne vor. In dieser herrscht ein Vakuum. Würde man ein so winziges Loch in die Glühbirne bohren, dass pro Sekunde eine Millionen Luftmoleküle in das Vakuum gesaugt würden, so würde es mehr als 100 Millionen Jahre dauern, bevor im Inneren der Glühbirne derselbe Luftdruck (und damit dieselbe Luftteilchenzahl) herrschte wie auf der übrigen Erde.”
Entstehung des Lebens
Erste Zellen sind vor drei Milliarden Jahren entstanden. Dies belegen deren versteinerte Abbilder. Davor stand (höchstens) ein Milliarde Jahre zur Verfügung, um Biobausteine herzustellen. Wenn man die gesamte Zeit, seit es lebende Zellen gibt, gleich ein Jahr setzt, dann sind erste menschenähnliche Wesen erst an Silvester um viertel nach drei nachmittags auf der belebten Erde erschienen. Ende Oktober hätte es bereits alle großen Gruppen wirbelloser Tiere gegeben, und um den siebzehnten Dezember herum wären die Dinosaurier ausgestorben.
Noch ein Wort zum Zellalter
Die Beobachtung, dass Zellen das Alter des sie umgebenden Körpers kennen, hat man mittlerweile nicht nur an Fibroblasten, sondern auch bei Lungen-, Haut-, Leber-, Arterienwand-, Augenlinsen- und T-Zellen (einer bestimmten Zellsorte des Immunsystems) gemacht. Man benutzte sicherheitshalber Gewebe von abgetriebenen Föten bis hin zu Zellen neunzigjähriger Greise. Es bestätigte sich, dass alle Zellen - auch losgelöst von ihren ursprünglichen Nachbarzellen - ihr Zellalter kennen. Zellen aus jungen Körpern vollführten bis zu sechzig Teilungen, Gewebe von älteren Menschen teilte sich mit zunehmendem Lebensalter der Spender immer seltener.
Jungfernzeugung
Eine besondere Art der Fortpflanzung ist die Jungfernzeugung (Parthenogenese). Dabei können sich unbefruchtete Eizellen zu lebenden Tieren entwickeln. Diese Art der Fortpflanzung kommt bei Rädertieren, Wasserflöhen (Daphnien), Stabheuschrecken, einigen Schmetterlingen, Rüsselkäfern und Blattläusen vor. Männliche Bienen, Wespen und Ameisen entstehen ebenfalls ausnahmslos durch Jungfernzeugung. Auch einige Eidechsenarten, die nur aus Weibchen bestehen, vollführen eine Scheinbegattung, die Nachkommen entstehen aber aus unbefruchteten Eizellen (z.B. Cnemidophorus uniparens). Sehr selten können sich auch unbefruchtete Hühnereier zu Küken entwickeln (eines unter Zehntausenden).
Neben diesen natürlichen Arten der Parthegonese gibt es auch die im Labor erzwungene Form. Entdeckt wurde die künstliche Jungfernzeugung um 1907 von Yves Delage, der damals Professor an der Pariser Sorbonne war. Delage hatte im (noch heute wunderschönen, besuchenswerten) meeresbiologischen Institut von Roscoff in Frankreich Seeigeleier zur Weiterentwicklung angeregt. Dazu hatte er dem Meerwasser in dem Zuchtbecken Zucker, Tannin, Kohlensäure und Ammoniak zugesetzt. Wie man heute weiß, können auch Hitze, Kälte, Druck und andere äußere Reize unbefruchtete Eier dazu bringen, sich weiterzuentwickeln.
Die Beobachtung, dass sich selten auch Eier von Reptilien (Echsen) und Amphibien (Frösche) zur Jungfernzeugung bringen lassen, wird von Zeit zu Zeit auf den Menschen übertragen. Dabei geht es um eine wörtliche Auslegung der biblischen Geschichte von Jesus, der als Sohn der Jungfrau Maria ebenfalls parthenogenetisch entstanden sein soll. Die Jungfernzeugung ist ein Sonderprogramm des Lebens. Sie erlaubt es, unter guten Umweltbedingungen sehr schnell sehr viele Nachkommen in die Welt zu setzen (Rädertiere, Wasserflöhe). Umgekehrt kann auch unter sehr schlechten Umweltbedingungen (Hitze, Kälte, Druck usw.), wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Befruchtung sinkt, noch ein Teil der Eier heranwachsen. Da eine Eizelle ohne die Erbsubstanz des Spermiums nur halb soviel DNA besitzt wie eine befruchtete Eizelle, gleichen die Jungferntiere diesen Mangel durch zusätzliche Erbsubstanzverdopplungen (Endomitosen) oder eine verminderte Anzahl von Zellteilungen bei gleichbleibender DNA-Herstellung (blockierte Anaphase) aus.
Auszeichnung für Reparaturmoleküle
Einige der Reparaturmoleküle, die in den Zellen arbeiten, wurden von der Wissenschaftszeitschrift Science im Dezember 1994 zum “Molekül des Jahres” ernannt. “Jeden Tag”, so Science, “gehen jeder Körperzelle mehr als 10.000 DNA-Bausteine verloren. Zum Glück sind die DNA-Reparaturmoleküle zur Stelle. Wie ein perfekt eingespieltes Ausbesserungsteam suchen sie unermüdlich nach DNA-Fehlern, schneiden defekte Stücke aus und füllen die Lücken anschließend wieder auf.”
Unliebsame Zellen
Auch Menschen tragen das Erbe ihrer Einzelligkeit in sich. Viele Einzeller, wie beispielsweise Joghurtbakterien, sind uns gute Freunde. Andere hingegen können uns empfindlich stören. Zwischen 1347 und 1350 tötete etwa der Pesterreger Yersinea pestis vierundsiebzig Millionen Europäer und bis etwa 1440 schubweise drei Viertel der Gesamtbevölkerung; das Fleckfieberbakterium Rickettsia prowazeki raffte - durch Läuse übertragen - die Armeen Napoleons bei seinem Rußlandfeldzug 1812 dahin und führte 1566 dazu, dass Maximilian II. mangels kampfbereiter Soldaten vom Angriff gegen den Ottomanenkaiser Süleyman ablassen musste. Heute (Ende des zwanzigsten Jahrhunderts) befinden wir uns weltweit in der siebten Welle (Pandemie) der Cholera. Der Stamm “El Tor” des Cholerabakteriums Vibrio cholerae begann seine Reise um den Erdball 1961 auf der Insel Celebes (heute ein Teil von Indonesien) und verbreitete sich dann über Java und die Philippinen nach Indien, in den Nahen Osten und nach Afrika. 1992 waren in Südamerika 1.500 Menschen erkrankt. Bis Mitte 1993 hatte “El Tor” bereits drei Millionen Menschen angesteckt, von denen einigen zehntausend starben. Der einzige Krankheitserreger, der weltweit als ausgerottet gilt, sind die Pocken (Blattern). 1977 war in Somalia das letzte Mal ein Mensch an Pocken erkrankt.
Die Ausrottung des Pockenvirus (Variola) war kein Zufall. Nach einem Antrag der sowjetischen Delegation in der Weltgesundheitsorganisation im Jahr 1958 begann 1967 die weltweite Vernichtung des Erregers durch Impfungen und Auflösung aller Forschungsbestände. Bis 1997 gab es, von der Weltgesundheitsorganisation genehmigt, nur noch zwei Proben von Variola auf der Erde. Die eine Virusprobe lag in einer Kühltruhe im Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie in Kolsowo bei Nowosibirsk der Russischen Föderation, die andere beim WHO Collaborating Centre on Smallpox im Center for Desease Control and Prevention (Seuchenbehörde) im U.S.-amerikanischen Atlanta. Am 30. Juni 1999 wurden die letzten Pockenviren endgültig vernichtet, nachdem die Basenabfolge, das heißt die Erbinformation, zweier Pockenvirusstämme bereits im Dezember 1994 komplett ermittelt war. (Ausgenommen von diesen Zahlen sind natürlich die Pockenbestände der Biowaffenfabriken.) Die Weltgesundheitsorganisation lagert nur noch 500.000 Impfeinheiten gegen Pocken und verfügt darüber hinaus über nichtinfektiöse Stämme des Pockenerregers.
Abgesehen von einem Laborunfall im englischen Birmingham im August 1978 (eine ungeimpfte Fotografin starb nach einem Pockenalarmtraining in einem mikrobiologischen Institut) konnte die Krankheit seit 1977 nicht mehr ausbrechen, ab 1980 gelten die Pocken als ausgestorbene Krankheit. In Deutschland bestand schon seit 1874 ein gesetzlicher Impfzwang; zuvor starb etwa jeder zwölfte Deutsche an den Pocken. Wahrscheinlich werden die heute noch aufbewahrten, letzten Viren bald endgültig vernichtet. Pocken werden mit dem Marburg-, Lassa- und Ebolavirus in die Gruppe Vier eingeordnet, das heißt die Gruppe der gefährlichsten Erreger. Als nächste Krankheit soll die Kinderlähmung (Poliomyelitis) ausgerottet werden. So werden beispielsweise mit Hilfe einer Spende der vier führenden Impfstoffhersteller Chiron Vaccines, Pasteur Mérieux Connaught, Smith Kline Beecham und Wyeth-Lederle Vaccines and Pediatrics, die im Dezember 1996 an die Weltgesundheitsorganisation zugesagt wurde, zur Zeit 30 Millionen Kinder in Afrika geimpft.
Lesetipps
- Dusk during Covid-19 pandemia in Cologne, Germany 2020
- Sebastian Fitzek befragt Mark Benecke
- Es wird immer neue Coronaviren geben
- Interview mit Mark Benecke & Linda Müller (Biotechnologie, iGEM 2020)
- Abwarten wäre ein Spiel mit dem Feuer gewesen
- Leipzig im Corona-Ruhezustand (Mai 2020)
- Diese Pandemie ist eine gute Übung
- Auf der Spuren von Corona: Virus-Check mit Dr. Mark Benecke
- Coronavirus: Straßenreinigung mit 4711